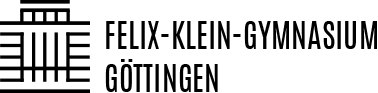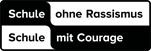Politik-Wirtschaft
Die Bedeutung des Faches Politik-Wirtschaft
Die zentrale Aufgabe des Unterrichtsfaches Politik Wirtschaft ist es, laut Kerncurriculum für das Gymnasium (Schuljahrgänge 8-10) (Niedersächsischen Kultusministerium (Hg, 2015), Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgänge 8-10, Politik-Wirtschaft, verbindlich ab dem Schuljahr 1.8.2015 für den Schuljahrgang 8 , ab dem 1.8.2016 für den Schuljahrgang 9, ab dem 1.8.2017 für den Schuljahrgang 10. Das Kerncurriculum kann als PDF-Datei von Niedersächsischen Bildungsserver (NIBIS) (http://www.cuvo.nibis.de) heruntergeladen werden), „die Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen, politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Sachverhalte, Probleme und Interdependenzen zu erfassen, zu beurteilen sowie Interessen zu artikulieren und Entscheidungen zu treffen. Die im Bereich der politischen und ökonomischen Bildung erwarteten Kompetenzen sollen die Lernenden dazu befähigen, sich in der demokratischen Gesellschaft in öffentlichen Angelegenheiten und ökonomischen Situationen verantwortungsbewusst einzubringen.“
Unsere Demokratie braucht mündige, informierte und sozial handelnde Bürgerinnen und Bürger. Das Fach Politik und Wirtschaft soll die Kenntnisse und Einsichten vermitteln, die zum Verständnis politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Sachverhalte erforderlich sind und die Grundlage eines politischen Urteils bilden sollen. Ziel ist eine verantwortliche Mitwirkung in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft vorzubereiten. Die moderne Gesellschaft ist geprägt durch sozialen, ökonomischen und politischen Wandel, der Innovation, Offenheit, Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft sowie soziale Verantwortung verlangt. Normative Leitbilder sind kontrovers und durch Interessen beeinflusst. Das muss auch im Unterricht in Politik und Wirtschaft deutlich werden; gleichzeitig hat sich der Unterricht an der normativen Wertordnung des Grundgesetzes und der niedersächsischen Verfassung zu orientieren und inhaltliche Orientierung zu vermitteln.
Ökonomische Bildung vermittelt Orientierung für den weiteren Bildungsgang und die Berufs- und Studienentscheidung. Im Verlauf des gymnasialen Bildungsganges ist deshalb ein Betriebspraktikum (am FKG im Jg. 11) verpflichtend. Simulationen und Planspiele sowie Schülerfirmen stellen zudem wichtige handlungsorientierte Möglichkeiten dar, betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse zu erwerben. Ökonomische Bildung soll die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzen, sich den Herausforderungen des technischen und ökonomischen Strukturwandels aktiv zu stellen. Sie muss dieser Dynamik Rechnung tragen, die Grundlagen für eine sachliche Beurteilung vermitteln und gleichzeitig den Zusammenhang zu den Schwerpunkten der politischen Bildung beachten.
Exkursionen
KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, Betriebserkundung VW Wolfsburg, Landtag Hannover, Bundestag und -rat in Berlin, Europäische Institutionen Brüssel/Straßburg.